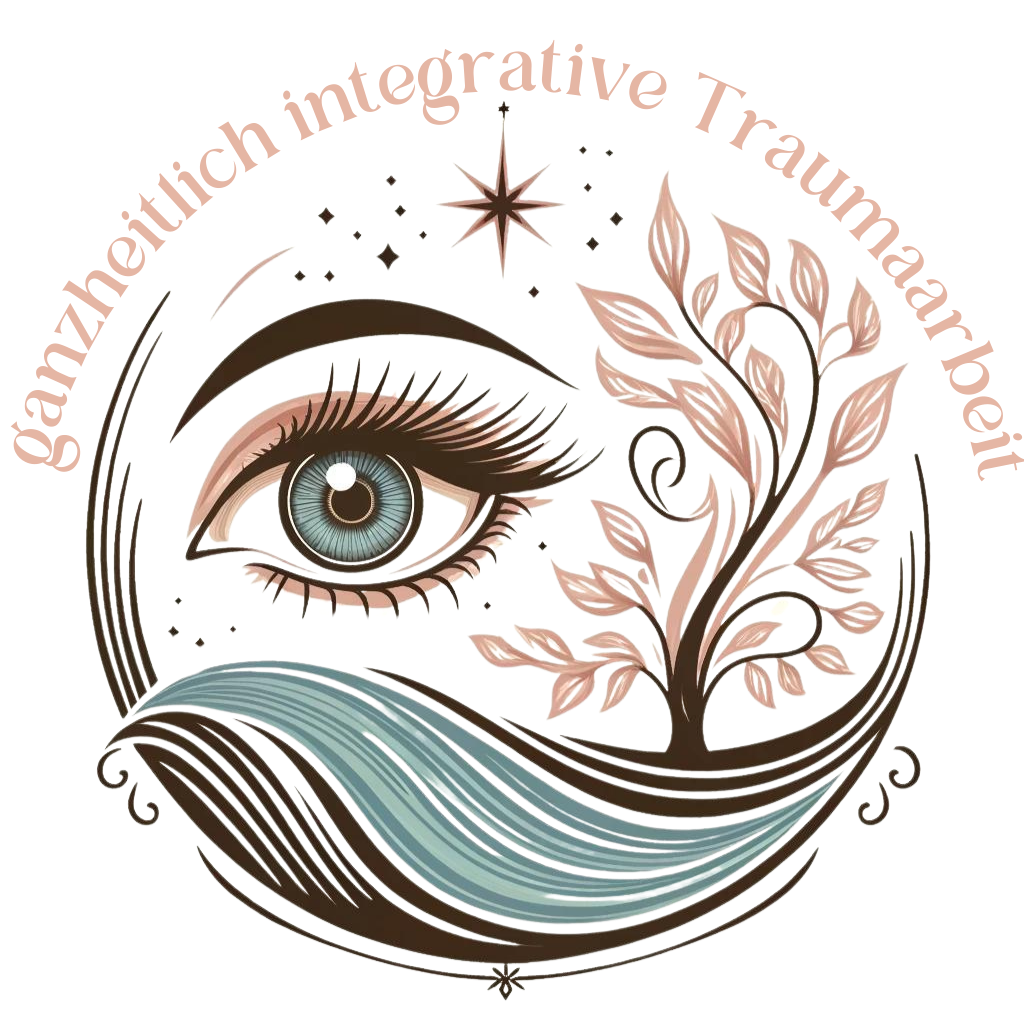Der eigentliche Schmerz eines Traumas liegt selten im sichtbaren Ereignis selbst, sondern in den stillen, oft unsichtbaren Folgen, die es in uns hinterlässt. Diese Folgen können das Leben nachhaltig beeinflussen und uns unbewusst in einer Weise prägen, die weit über das eigentliche Erlebnis hinausgeht. Sie sind wie Wunden auf der Seele, die erst im richtigen Licht sichtbar werden, und doch bestimmen sie unsere Wahrnehmung und unser Verhalten in vielen Bereichen.
Laut Gabor Maté Experte für Trauma, Sucht, Stress und kindliche Entwicklung,sagte:
„Trauma ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was in dir passiert, als Folge dessen, was dir passiert ist.“
Dieses Zitat bringt treffend zum Ausdruck, dass die eigentliche Traumabelastung in den inneren Prozessen und Reaktionen liegt, die durch ein Ereignis ausgelöst werden – und nicht im Ereignis selbst.
Was ist ein Trauma?
Ein Trauma ist mehr als ein schmerzhaftes Erlebnis. Es ist eine tiefe innere Erschütterung, die oft ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins hinterlässt. Es ist das Erleben einer überwältigenden Situation, die der Mensch mit seinen normalen Bewältigungsstrategien nicht mehr verarbeiten kann. Traumata sind individuell – was für einen Menschen traumatisch ist, kann für einen anderen bewältigbar sein.

Die verschiedenen Formen von Trauma
Die grundlegende Unterscheidung zwischen Monotrauma und Entwicklungs- und Bindungstrauma ist wichtig, um die tiefgreifenden Unterschiede in der Entstehung und den Auswirkungen besser zu verstehen. Beide haben schwerwiegende Folgen, unterscheiden sich jedoch in ihrer Entstehung und ihren Merkmalen.
Monotrauma
Ein Monotrauma entsteht durch ein einzelnes, stark belastendes Ereignis, das unser Nervensystem überfordert. Dies kann ein Unfall, ein Überfall, eine Naturkatastrophe oder ein ähnliches Ereignis sein. Ein solches Trauma ist oft klar definiert und die Person kann den Zeitpunkt und das Ereignis genau benennen. Die häufigsten Symptome eines Monotraumas sind Flashbacks, Albträume und akute Stressreaktionen. Monotrauma können oft gezielt behandelt werden, da die Quelle des Traumas klar erkennbar ist.
Die Folgen, die ein Trauma in unserer Seele hinterlässt, können vielfältig und tiefgreifend sein. Sie äussern sich häufig in Form von:
- Emotionale Wunden: anhaltende Gefühle von Angst, Scham, Wut oder Trauer, die durch das Trauma ausgelöst wurden.
- Körperliche Reaktionen: Verspannungen, Schmerzen oder ständige Anspannung im Körper, die durch unverarbeitete Traumata verursacht werden können.
- Veränderungen des Selbstwertgefühls: Ein Gefühl der Unzulänglichkeit, der Scham oder der Entfremdung von sich selbst, das durch das Trauma hervorgerufen wird.
- Gedankenkreise und Flashbacks: Wiederkehrende belastende Gedanken, Bilder oder Flashbacks, die die betroffene Person immer wieder zum Trauma zurückversetzen.
- Beziehungen: Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen oder gesunde Bindungen einzugehen, die durch das Trauma beeinträchtigt sind.
- Vermeidungsverhalten: innerer Widerstand oder die Tendenz, bestimmte Situationen, Orte oder sogar Menschen zu meiden, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen.
Diese Folgen können in Form von unverarbeiteten Gefühlen und nicht integrierten Erfahrungen im Leben der Betroffenen fortbestehen und das alltägliche Leben beeinträchtigen, bis sie durch Heilungsprozesse aufgearbeitet werden.
Entwicklungs- und Bindungstrauma
Entwicklungs- und Bindungstraumata entstehen schleichend und unbemerkt. Sie sind das Ergebnis wiederholter Erfahrungen von emotionaler Mangelversorgung, Vernachlässigung oder Missbrauch in der Kindheit, oft in der Phase, in der die Grundlagen für Bindungen und Selbstwertgefühl gelegt werden. Wenn ein Kind wiederholt das Gefühl hat, dass seine Bedürfnisse nicht wichtig sind oder seine Gefühle nicht respektiert werden, führt dies zu einer tiefen Verunsicherung in Bezug auf die Welt und die Beziehungen zu anderen Menschen. Entwicklungs- und Bindungstraumata hinterlassen nachhaltige Spuren in Psyche und Körper und prägen die Persönlichkeit, das Selbstbild und die Fähigkeit zu vertrauensvollen Beziehungen.
Viele der genannten Folgen von Monotraumata können auch bei Bindungs- und Entwicklungstraumata auftreten, da diese Traumatisierungsformen tiefgreifende Auswirkungen auf das emotionale und psychische Wohlbefinden haben. Die Symptome und Folgen von Bindungs- und Entwicklungstraumata können jedoch in bestimmten Bereichen besonders ausgeprägt sein:
- Emotionales Erleben: Menschen mit Bindungs- oder Entwicklungstraumata haben oft Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren. Sie können intensive Gefühle von Unsicherheit, Ablehnung oder Angst erleben, weil ihre grundlegenden Bindungsbedürfnisse in der frühen Kindheit nicht erfüllt wurden.
- Verhalten in Beziehungen: Ein besonders starkes Merkmal von Bindungstraumata ist die Schwierigkeit, stabile und sichere Beziehungen einzugehen. Betroffene können entweder zu sehr an anderen Menschen hängen (abhängig) oder Nähe stark vermeiden (emotional distanziert). Sie haben oft ein verzerrtes Selbstbild und grosses Misstrauen gegenüber anderen.
- Selbstwertgefühl: Ein stark beeinträchtigtes Selbstwertgefühl ist typisch für Menschen mit Entwicklungs- oder Bindungstraumata. Sie neigen dazu, sich als „nicht liebenswert“ oder „nicht bindungsfähig“ zu erleben, was häufig zu innerer Leere und Identitätsproblemen führt.
- Körperliche Symptome: Aufgrund der langen Belastung durch ungelöste Traumata können bei Bindungs- und Entwicklungstraumata auch körperliche Symptome wie chronische Verspannungen, Migräne oder andere psychosomatische Beschwerden auftreten.
- Vermeidungsverhalten und Flashbacks: Insbesondere bei Entwicklungstraumata, die sich häufig in der Kindheit ereignen, kann es zu Flashbacks und dissoziativen Symptomen kommen, bei denen sich die Betroffenen in belastende frühkindliche Erlebnisse zurückversetzt fühlen.
- Veränderte Wahrnehmung der Welt und anderer Menschen: Bindungs- und Entwicklungstraumata können dazu führen, dass das Vertrauen in die Welt und in andere Menschen stark beeinträchtigt ist. Betroffene erleben die Welt oft als gefährlich oder abweisend und haben Schwierigkeiten, zwischenmenschliche Geborgenheit und Nähe zu erfahren.

Sind die Folgen von Bindungs- und Entwicklungstraumata schwerer als bei einem Monotrauma?
Die Folgen von Bindungs- und Entwicklungstraumata sind oft tiefgreifender und langwieriger als die eines einzelnen Monotraumas, da sie das grundlegende Vertrauen in sich und die Welt sowie die Fähigkeit zu sicheren Bindungen betreffen. Man kann jedoch nicht pauschal sagen, dass sie immer „schwerer“ sind, da der Schweregrad der Traumafolgen von mehreren Faktoren abhängt, wie z.B. der Art des Traumas, der Resilienz der betroffenen Person und dem zur Verfügung stehenden unterstützenden Umfeld.
Einige Unterschiede zwischen den beiden:
Bindungs- und Entwicklungstraumata:
1. Langfristige Auswirkungen auf das Selbstbild: Diese Art von Trauma betrifft häufig die früheste Lebensphase, in der das Selbstbild und die Fähigkeit, stabile Beziehungen aufzubauen, geprägt werden. Menschen, die in ihrer frühen Kindheit vernachlässigt, missbraucht oder emotional nicht unterstützt wurden, entwickeln oft ein unsicheres oder verzerrtes Selbstbild und ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen.
2. Beziehungen und Bindungen: Menschen mit Bindungs- und Entwicklungstraumata haben oft grosse Schwierigkeiten, gesunde und stabile Beziehungen zu führen. Sie neigen entweder zu Überanpassung und Abhängigkeit oder vermeiden Nähe und Intimität. Dies kann zu einem Gefühl der Isolation und Einsamkeit führen, welches das Leben nachhaltig belastet.
3. Emotionale und psychische Probleme: Da diese Traumata auf einer tief emotionalen und psychischen Ebene wirken, können sie zu chronischen Zuständen wie Angst, Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörungen und anderen psychischen Erkrankungen führen. Die Verarbeitung dieser frühkindlichen Erfahrungen ist besonders schwierig, da sie meist tief im Unbewussten verankert sind.
4. Komplexität der Heilung: Die Heilung von Bindungs- und Entwicklungstraumata ist oft komplex und langwierig, da sie viele verschiedene Lebensbereiche betreffen, von der Selbstwahrnehmung bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine effektive Therapie muss auf mehreren Ebenen gleichzeitig ansetzen, oft mit traumasensiblen Ansätzen wie der Polyvagalen Theorie oder der Ego-State-Therapie.
Monotrauma:
- Akute Traumatisierung, eindeutige Ursache: Ein Monotrauma (z.B. ein Unfall, eine Naturkatastrophe oder ein einmaliges schweres Ereignis) betrifft in der Regel eine einzelne, sehr belastende Erfahrung. Die Folgen sind oft ebenfalls schwerwiegend, wie z.B. eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Flashbacks, Alpträume oder Angststörungen, aber die Auswirkungen betreffen in der Regel nicht so tief greifend die gesamte Lebensgeschichte einer Person wie bei einem Bindungs- oder Entwicklungstrauma.
- Behandelbarkeit: Monotraumata können in der Regel mit gezielten und oft schnell zugänglichen Heilungsprozessen behandelt werden. Menschen können sich mit Unterstützung schneller von einem akuten Trauma erholen als von den jahrelangen Auswirkungen eines Bindungs- oder Entwicklungstraumas.
- Klarere Symptome: Während Bindungs- und Entwicklungstraumata oft subtile und chronische Auswirkungen haben, die sich auf die gesamte Lebensgeschichte auswirken, sind die Symptome eines Monotraumas meist klarer und spezifischer. Dies erleichtert manchmal die Diagnosestellung und die Einleitung einer geeigneten Behandlung.
Obwohl Monotrauma ebenfalls schwerwiegende und lang anhaltende Folgen haben können, sind Bindungs- und Entwicklungstraumata in der Regel komplexer und tiefgreifender, da sie die grundlegende Fähigkeit betreffen, mit anderen Menschen in sicheren und gesunden Beziehungen zu interagieren und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Die Auswirkungen von Bindungs- und Entwicklungstraumata sind lebenslang und können zu wiederkehrenden Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen (Emotionen, Beziehungen, Selbstwahrnehmung) führen. Insofern kann man sagen, dass die langfristige und vielschichtige Natur von Bindungs- und Entwicklungstraumata oft als „schwerer“ empfunden wird.
Die Folgen von Monotrauma und Entwicklungs- und Bindungstrauma im Vergleich
Wie sich die Folgen der beiden Traumaarten unterscheiden können:

Die Narben im Inneren: Warum es so schwer ist, sich von Entwicklungs- und Bindungstraumata zu befreien
Während Monotrauma oft akute, aber klar erkennbare Spuren hinterlassen, sind die Folgen von Entwicklungs- und Bindungstraumata subtil und vielschichtig. Ein Mensch mit einem Bindungstrauma hat oft ein tiefes, oft unbewusstes Gefühl, dass die Welt unsicher ist und dass Beziehungen immer eine Form von Gefahr oder Verletzung mit sich bringen. Diese tief verwurzelten Überzeugungen beeinflussen viele Lebensbereiche, oft, ohne dass sich die Betroffenen dessen bewusst sind. Der Heilungsprozess ist hier langwieriger und bedarf einer sicheren und vertrauensvollen therapeutischen Beziehung, in der die Person lernen kann, sich selbst und anderen neu zu begegnen.

Mein Ansatz: Ganzheitliche Begleitung zur Heilung
Als traumasensible Begleiterin ist es mir wichtig, die innere Welt meiner Klientinnen zu verstehen und sie dabei zu unterstützen, verborgene Verletzungen und Muster ans Licht zu bringen. Jeder Mensch ist einzigartig und bringt eigene Lebenserfahrungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen mit. Deshalb arbeite ich mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Seele einbezieht.
- Polyvagal-Theorie: Diese Theorie hilft, die neurobiologischen Grundlagen von Trauma zu verstehen. Durch Atem- und Achtsamkeitsübungen unterstütze ich meine Klientinnen dabei, ihr Nervensystem zu beruhigen und das Gefühl von Sicherheit in sich selbst wieder zu entdecken.
- Ego-State-Therapie: In dieser Arbeit mit den verschiedenen inneren Anteilen lernen die Betroffenen, die verletzten und schützenden Anteile in sich wahrzunehmen und zu integrieren. Besonders für Menschen mit Entwicklungs- und Bindungstraumata kann dies hilfreich sein, um emotionale Wunden zu heilen und die innere Vielfalt anzuerkennen.
- Hypnosetherapie: Durch sanfte Hypnose kann der Zugang zum Unterbewusstsein erleichtert werden, was oft tief verborgene Überzeugungen und frühere Erlebnisse aufdeckt. Dies ist besonders bei Bindungstraumata wirksam, da unbewusste Erfahrungen oft tiefe Wurzeln schlagen.
- Einfühlsames Zuhören und Begleiten: Ein sicherer Raum und die Bereitschaft, sich auf eine unterstützende, heilende Beziehung einzulassen, sind entscheidend. Traumatisierte Menschen brauchen Mitgefühl und Verständnis, um neue, positive Bindungserfahrungen zu machen, die das Gehirn nachhaltig heilen können.
Der Weg zur Selbstheilung
Für traumatisierte Menschen ist der Weg zur Heilung oft ein langer Prozess, in dem Vertrauen, Geduld und Selbstmitgefühl eine zentrale Rolle spielen. Während Monotrauma oft durch gezielte therapeutische Ansätze aufgelöst werden können, erfordert die Heilung von Entwicklungs- und Bindungstraumata Geduld und intensive Begleitung auf emotionaler und zwischenmenschlicher Ebene. Durch eine ganzheitliche Arbeit, die Körper, Seele und Geist integriert, können die tiefen Spuren des Traumas Schritt für Schritt aufgelöst werden.